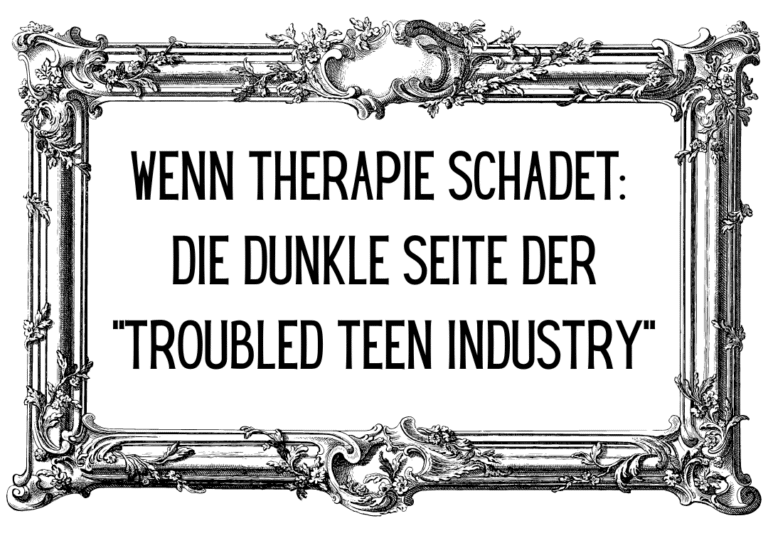Wenn man „Selbstliebe“ bei Google eingibt, bekommt man sofort Antworten. Tipps. Ratschläge. Überschriften wie: Selbstliebe lernen, Die besten Übungen für mehr Selbstakzeptanz, So stärkst du die Freundschaft mit dir selbst. Listen, Routinen, To-dos. Fast so, als wäre Selbstliebe etwas, das man sich Schritt für Schritt aneignen kann, wenn man es nur richtig angeht.
Ich habe nie wirklich darüber nachgedacht, ob ich mich liebe oder nicht. Ich habe einfach gelebt, funktioniert, mich angepasst, mich hinterfragt, ohne dem Ganzen einen Namen zu geben. Erst mit Abstand wurde mir bewusst, wie sehr sich meine Beziehung zu mir selbst immer wieder verschoben hat.
Aus diesem Rückblick ist auch dieser Blogpost entstanden. Er ist kein Leitfaden für mehr Selbstliebe und keine Anleitung, der man folgen kann. Er ist ein Innehalten. Ein Zurückschauen auf innere Verschiebungen, auf Phasen des Verlusts und des Wiederfindens. Auf eine Beziehung zu mir selbst, die sich im Laufe meines Lebens immer wieder neu geformt hat und sich wahrscheinlich auch weiterhin verändern wird.
Als Selbstliebe noch selbstverständlich war
Wenn ich an meine Kindheit denke, denke ich nicht an Selbstliebe als Konzept. Dieses Wort spielte damals keine Rolle. Und vielleicht war genau das der Punkt. Meine Eltern erzählen mir bis heute, wie offen und neugierig ich als Kind war. Dass ich auf andere Kinder zugegangen bin, fremde Menschen angesprochen habe, ganz egal ob wir im Urlaub waren, im Restaurant oder irgendwo in der Öffentlichkeit.
Nähe war für mich nichts, das man sich erarbeiten musste. Sie war einfach da. Ich habe Menschen angesprochen, wenn mir etwas an ihnen gefallen hat. Auf der Straße, im Vorbeigehen, ohne großes Zögern. Vielleicht war das manchmal ein bisschen nervig. Vielleicht auch unangemessen. Aber es kam aus keiner Unsicherheit heraus, sondern aus Selbstverständlichkeit.
Was mir heute daran auffällt, ist weniger die Extrovertiertheit an sich als das Gefühl dahinter. Ich habe mich gezeigt, ohne mich dabei selbst zu beobachten. Ohne inneren Kommentar, ohne die Frage, ob ich richtig bin oder passe. Ich hatte kein Bedürfnis, mich zurückzunehmen oder mich vorher einzuordnen. Ich war einfach da und habe mir Raum genommen, ohne ihn erklären oder rechtfertigen zu müssen.
Rückblickend war das eine Form von Selbstliebe, die noch keinen Namen brauchte. Kein bewusster Akt, kein inneres Arbeiten, sondern ein natürliches Vertrauen darin, dass es okay ist, so zu sein, wie man ist.

Der Moment, in dem Selbstzweifel leise begannen
Ich kann keinen klaren Moment benennen, an dem sich alles verändert hat. Es war kein Bruch, kein einschneidendes Ereignis. Es war eher ein langsames Verschieben. Irgendwann begann ich, mich selbst nicht mehr nur zu erleben, sondern auch zu beobachten. Zu registrieren, wie ich wirke, wie ich ankomme, wie ich gelesen werde.
Diese neue Perspektive war nicht sofort negativ. Sie war subtil. Aber sie brachte eine Distanz mit sich, die vorher nicht da war. Ich war nicht mehr nur Teil des Geschehens, sondern begann, mich darin einzuordnen.
Vergleiche, die sich einschleichen
Mit dieser Selbstbeobachtung kamen auch Vergleiche. Erst ganz leise, fast unbemerkt. Wie verhalten sich die anderen, was scheint gut anzukommen, wer passt besser in das Bild, das erwartet wird. Ich begann mich zu messen, ohne genau zu wissen, woran eigentlich.
Vergleiche machten mich vorsichtiger. Sie erzeugten das Gefühl, dass es Regeln gibt, die ich bisher nicht kannte. Regeln darüber, wie man sein sollte, wie viel man sein darf und wann man lieber still ist.
Anpassung als Schutzmechanismus
Ich habe mich nicht bewusst entschieden, mich anzupassen. Es war kein aktiver Entschluss. Es fühlte sich eher wie ein Schutzmechanismus an. Weniger auffallen, weniger Angriffsfläche bieten, weniger falsch machen.
Ich begann, mein Verhalten feiner abzustimmen. Meine Offenheit bekam Grenzen, meine Spontanität Filter. Dinge, die früher einfach passiert sind, wurden innerlich abgewogen. Nicht aus Unsicherheit im klassischen Sinn, sondern aus dem Wunsch heraus, dazuzugehören.
Emotional leiser werden
Äußerlich wirkte ich vielleicht immer noch offen. Innerlich jedoch wurde ich ruhiger, zurückhaltender. Ich teilte weniger ungefiltert, hielt Gefühle eher bei mir. Nicht, weil sie nicht da waren, sondern weil ich begann, sie zu regulieren, bevor sie sichtbar wurden.
Dieser Übergang war leise. So leise, dass ich lange nicht gemerkt habe, wie sehr er mich verändert hat. Erst viel später wurde mir bewusst, dass ich mich in dieser Phase langsam von einem Teil meiner ursprünglichen Selbstverständlichkeit entfernt habe.
Pubertät, Kontrolle und der Versuch, sich selbst festzuhalten
Die leisen Selbstzweifel waren also bereits da, als mein Leben sich erneut veränderte. Die innere Distanz, die sich zuvor aufgebaut hatte, traf nun auf äußere Umbrüche. Mit der Pubertät kam nicht nur ein neuer Blick auf mich selbst, sondern auch ein Körper, der sich sichtbar veränderte. Etwas, das vorher eher im Inneren stattgefunden hatte, wurde plötzlich auch körperlich spürbar.
Anpassen, um dazuzugehören
Ich war es gewohnt, in Bewegung zu sein. In meiner Kindheit bin ich sehr oft umgezogen. Neue Orte, neue Umfelder, neue Menschen. Und genauso oft Abschiede. Ich will das auch niemanden vorwerfen. Diese Zeit hat mir viele wertvolle Erfahrungen geschenkt und mir ermöglicht, Menschen und neue Orte kennenzulernen, die mich geprägt haben. Dafür bin ich sehr Dankbar.
Gleichzeitig bedeutete diese ständige Veränderung aber auch, dass wenig wirklich konstant war. Beziehungen entstanden schnell, waren intensiv, aber selten dauerhaft. Vielleicht habe ich genau dadurch früh gelernt, flexibel zu sein. Mich einzufügen. Mich anzupassen, ohne es bewusst zu hinterfragen.
Ein weiterer Bruch
Als ich mich dann entschieden habe, zu meinem Vater zu ziehen, kam erneut eine große Veränderung dazu. Ein neuer Lebensabschnitt, neue Dynamiken, neue Unsicherheiten. Meine Eltern hatten sich bereits getrennt, als ich drei Jahre alt war. Davor hatte ich meinen Vater meist nur alle zwei Wochen gesehen. Ich habe mir lange mehr Zeit mit ihm gewünscht, mehr Nähe, und vorallem ein Gefühl von einem festen Zuhause.
Der Umzug war deshalb nicht nur ein Wechsel des Wohnortes, sondern auch der Versuch, etwas nachzuholen. Mehr Zeit mit meinem Vater. Ein anderes Zuhause. Eine Nähe, die vorher nur punktuell möglich war. Und auch wenn ich mir diesen Schritt gewünscht habe, war er emotional nicht (immer) leicht.
Mit dem Umzug kam eine neue Realität. Andere Routinen, andere Regeln, ein neuer Alltag. Meine Mutter war nicht mehr jeden Tag da, vieles, was vorher vertraut war, fehlte plötzlich. Ich musste mich neu orientieren, neu einfinden, ohne genau zu wissen, wie.
Gleichzeitig war ich mitten in einer Phase, in der sich ohnehin alles veränderte. Mein Körper begann sich zu wandeln, ich bekam meine Periode zum ersten Mal, mein Inneres war in Bewegung. Rückblickend war das viel auf einmal. Auch wenn ich den Schritt bewusst gegangen bin, hat mir in dieser Zeit wahrscheinlich etwas Halt gefehlt. Etwas, woran ich mich innerlich festmachen konnte, während außen so vieles neu war.
Dieses Gefühl von fehlender Stabilität wurde mir damals nicht sofort bewusst. Aber es war da. Und es spielte später eine größere Rolle, als ich zu diesem Zeitpunkt ahnen konnte. Darauf komme ich noch zurück.
Kontrolle als Versuch von Stabilität
In dieser Zeit begann ich, Halt dort zu suchen, wo er greifbar schien. Nicht bewusst, nicht geplant. Es begann wie ein stilles Festhalten. Die Kontrolle über Essen wurde zu etwas, das Struktur gab, zu etwas, das verlässlich war, wenn sich sonst vieles entzogen hat. Ich nahm immer mehr ab. Schritt für Schritt, fast unbemerkt, bis aus diesem Versuch von Halt eine Essstörung wurde und ich schließlich in eine Magersucht rutschte.
Mein Körper rückte immer mehr in den Mittelpunkt. Die Beziehung zu ihm wurde laut, angespannt, kontrolliert. Essen war kein neutraler Teil des Alltags mehr, sondern etwas, das ich regulierte, über das ich nachdachte, das Raum einnahm. Rückblickend ging es dabei nicht nur um Ablehnung meines Körpers als um das Bedürfnis nach Sicherheit. Kontrolle versprach kurzzeitig Stabilität, dort, wo sie mir innerlich fehlte.
Eine verzerrte Wahrnehmung
An dieser Stelle möchte ich zuerst etwas zu den Bildern sagen, die ich hier teile. Sie zeigen nicht das schmalste Gewicht, das ich damals hatte. Und dennoch berühren sie mich bis heute. Nicht, weil sie etwas Falsches zeigen oder ich mich dafür schäme, sondern weil sie mich an einen inneren Zustand erinnern, der von außen kaum sichtbar war.

Heute weiß ich: Wenn „genug“ nie erreicht wird, liegt es nicht am Körper.
Ich erinnere mich gut an diesen Urlaub. Die Bilder sind in Amerika entstanden, auf einer Reise mit meiner Familie. Nach außen war es ein ganz normaler Trip. Wir waren unterwegs, haben Fotos gemacht, Zeit miteinander verbracht. Und gleichzeitig weiß ich noch genau, dass es innerlich genau dort begonnen hat, sich erst so richtig zuzuspitzen.
In dieser Zeit habe ich jede Kalorie gezählt. Ich habe meinen Körper täglich analysiert, im Spiegel, in Gedanken, immer wieder. Egal, was ich gesehen habe, es hat sich nie richtig angefühlt. Ich fand mich weiterhin zu dick. Mein Blick auf mich selbst war permanent kritisch, kontrollierend und komplett verzerrt.
Ich hatte mich so sehr auf diesen Urlaub gefreut. Habe Monate vorher jeden Tag abgehakt, bis es endlich so weit war. Habe mich gefreut auf das amerikanische Essen, die Fast-Food-Ketten, auf all das, was man sonst eben so aus den Filmen kennt, auf das volle Erleben. Und trotzdem habe ich fast nichts davon zugelassen. Ich habe nichts probiert, nichts genossen, weil mein Kopf dauerhaft mit Zahlen, Regeln und Kontrolle beschäftigt war.
Was man auf diesen Fotos ebenfalls nicht sieht, ist, wie viel Energie ich darauf verwendet habe, diesen Zustand zu verbergen. Nicht nur vor anderen, sondern auch vor mir selbst. Ich habe bewusst versucht, Normalität aufrechtzuerhalten, Fürsorge anzunehmen, ohne sie wirklich zuzulassen. Nach außen habe ich Erklärungen geliefert, Dinge relativiert, beschwichtigt. Nicht aus Unwissenheit, sondern aus dem Wunsch heraus, die Kontrolle nicht zu verlieren.
Was man außerdem nicht sieht, ist, dass das Abnehmen danach weiterging. Dass dieser Urlaub kein Endpunkt war, sondern ein Anfang. Über Wochen und Monate hinweg. Mein Körper begann darauf zu reagieren. Ich verlor meine Periode für mehrere Monate, ein deutliches Zeichen dafür, dass ich längst über eine Grenze gegangen war, die ich selbst noch nicht wahrnehmen konnte. Erst nach den Sommerferien, als ich wieder in der Schule war, haben sich meine Lehrer gemeldet. Sie haben gesehen, wie abrupt sich mein Körper verändert hatte, haben Fragen gestellt und schließlich meinen Vater kontaktiert.
Ich könnte an dieser Stelle noch viel mehr erzählen. Über das bewusste Verbergen, über Strategien, über Situationen. Aber ich entscheide mich dagegen. Nicht, weil diese Erfahrungen unwichtig wären, sondern weil ich weiß, wie fragil Menschen in ähnlichen Situationen sein können.
Ich teile diese Bilder bewusst und gleichzeitig sehr begrenzt. Sie stehen nicht für meinen Körper, sondern für eine Wahrnehmung, die damals weit von mir selbst entfernt war.
Diese Zeit hat meine Beziehung zu mir selbst tief geprägt. Sie zeigt mir bis heute, wie eng innere Unsicherheit, äußere Veränderungen und das Bedürfnis nach Kontrolle miteinander verbunden sein können. Und wie schnell der Versuch, sich selbst zu stabilisieren, in etwas kippen kann, das einem schadet.
Heilung ist kein gerader Weg
Aus dieser Phase herauszufinden, fühlte sich damals wie ein Erfolg an. Und das war es auch. Aber „es geschafft zu haben“ bedeutete nicht, dass alles erledigt war. Es bedeutete nur, dass das Akute vorbei war. Dass ich wieder normal essen konnte, wieder funktionierte, wieder in den Alltag zurückfand.
Erst mit zeitlichem Abstand zeigte sich auch gesundheitlich, was diese Veränderung bedeutete. Nach knapp einem Jahr bekam ich meine Periode wieder, ein leises, aber wichtiges Zeichen dafür, dass mein Körper begonnen hatte, sich zu stabilisieren. Nicht auf Knopfdruck, sondern Schritt für Schritt, in seinem eigenen Tempo.
Was allerdings blieb, war eine sensible Beziehung zu meinem Körper. Eine, die sich nicht mehr selbstverständlich anfühlte, sondern beobachtet, bewertet und manchmal fragil.
Das Auf und Ab
In den Jahren danach erlebte ich immer wieder ein Auf und Ab. Phasen, in denen ich zunahm, mich unsicherer wahrnahm, strenger mit mir wurde. Und Phasen, in denen ich wieder abnahm, mich wohler fühlte. Dieses Schwanken war nicht nur körperlich, sondern vor allem emotional.
Mein Körper wurde zu etwas, das Stimmung spiegelte. Zahlen auf der Waage, Spiegelbilder, Kleidung, die enger oder weiter saß – all das bekam mehr Bedeutung, als es eigentlich verdient hätte. Nicht, weil ich es wollte, sondern weil sich mein inneres Empfinden daran festmachte.
Wohlfühlgefühl statt Wohlfühlgewicht
Lange Zeit dachte ich, es gäbe ein bestimmtes Gewicht, bei dem sich alles leichter anfühlt. Und ja, ich glaube immer noch, dass es Phasen gibt, in denen man sich im eigenen Körper wohler fühlt als in anderen. Daran ist nichts falsch. Es ist menschlich, sich in seinem Körper sicher und zuhause fühlen zu wollen.
Der entscheidende Unterschied liegt für mich heute woanders. Nicht im Gewicht selbst, sondern darin, was ich daran knüpfe. Sobald ein bestimmter Zustand zur Bedingung wird – für Selbstwert, für Sicherheit, für Ruhe – wird es fragil. Dann hängt zu viel an etwas, das sich jederzeit wieder verändern kann.
Deshalb denke ich heute weniger in Zahlen oder Zielpunkten. Sondern in Zuständen. In Stabilität. In Alltagstauglichkeit. In dem Gefühl, mich in meinem Körper bewegen zu können, ohne ständig gegen ihn zu arbeiten.
Die emotionale Last hinter Zahlen und Spiegelbildern
Was nämlich oft unterschätzt wird, ist nicht das Gewicht selbst, sondern das, was es innerlich auslöst. Die ständige Aufmerksamkeit. Das Vergleichen. Das leise Abgleichen im Kopf. Dieses permanente Beobachten des eigenen Körpers. Es ist ermüdend, nicht körperlich, sondern emotional. Weil kaum ein Moment bleibt, in dem man einfach nur da ist, ohne sich selbst zu prüfen.
Heilung bedeutete für mich deshalb nie, dass Unsicherheit komplett verschwindet. Sondern dass ich gelernt habe, diesen Momenten anders zu begegnen. Sie nicht sofort als Rückschritt zu lesen. Sie nicht größer zu machen, als sie sind. Sondern sie einzuordnen als Teil eines Prozesses, der sich bewegt, der nicht linear ist und das auch nicht sein muss.
Irgendwann habe ich gemerkt, dass Zahlen für mich kein neutraler Bezugspunkt sind. Ich wiege mich heute z.B nur noch sehr selten. Nicht aus Verdrängung, sondern aus Selbstschutz(!). Stattdessen achte ich stärker darauf, wie ich mich in meinem Körper fühle, wie ich mich im Spiegel wahrnehme, ob da Spannung oder eher Ruhe ist. Daran orientiere ich mich mehr als an einer Zahl.
Ich weiß außerdem, dass ich eine Essstörung hatte. Und ich kenne meine Muster. Ich habe ADHS, und mit ihm kommt auch der Hyperfokus. Manche Dinge können sich extrem festsetzen: Zahlen, Regeln oder Kontrollmechanismen geben kurzfristig Struktur, können aber auch schnell zu Fixpunkten werden, an denen sich alles aufhängt. Das zu wissen, ist kein Zeichen von Schwäche, sondern von Verantwortung.
Das muss nicht jeder so handhaben. Menschen finden unterschiedliche Wege, mit ihrem Körper und ihrer Geschichte umzugehen. Das hier ist meiner. Einer, der mir hilft, weniger zu kämpfen und mehr bei mir zu bleiben.
Der leise Perspektivwechsel
Selbstliebe neu denken
Irgendwann wurde mir also klar, dass ich Selbstliebe lange falsch verstanden hatte. Ich hatte sie an Zustände geknüpft. An Phasen, in denen ich mich wohlfühlte. An Momente, in denen mein Körper sich richtig anfühlte oder mein Leben geordnet wirkte. Doch genau das machte sie so fragil.
Je mehr ich darüber nachdachte, desto deutlicher wurde mir: Eine Selbstliebe, die an Bedingungen geknüpft ist, hält nur so lange, wie alles passt. Und genau dann bricht sie weg, wenn man sie eigentlich am meisten bräuchte.
Der Körper als Ausdruck, nicht als Maßstab
Ich begann zu verstehen, dass mein Körper weniger Ursache als Ausdruck ist. Ausdruck von Stress, Überforderung, innerer Sicherheit oder deren Fehlen. Ihn zum Maßstab zu machen, bedeutete, Symptome zu bewerten, statt Ursachen zu verstehen.
Diese Perspektive hat mir erlaubt, meinen Körper nicht länger als Projekt zu betrachten, das optimiert werden muss, sondern als Teil von mir, der reagiert, kommuniziert und Schutz sucht.
Bewegung aus Fürsorge, nicht aus Selbstablehnung
Auch mein Blick auf Bewegung hat sich verändert. Früher war Sport für mich eng mit Kontrolle und Kompensation verbunden. Ich habe ihn aus Selbstzweifeln heraus gemacht. Heute sehe ich Bewegung als Ausdruck von Selbstliebe. Als etwas, das ich für meine Gesundheit tun sollte, für meine mentale Stabilität und für mein Wohlbefinden.
Ähnlich ist es mit der Ernährung. Nicht als Regelwerk, nicht als etwas, das ich perfekt umsetzen muss, sondern als Teil eines Lifestyles, der mir gut tut. Essen darf nähren, Energie geben, unterstützen. Nicht bestrafen, nicht ausgleichen, nicht kontrollieren.
Für mich geht es heute weniger um Disziplin und mehr um Intention. Um die Frage, ob das, was ich tue, aus Fürsorge entsteht oder aus Ablehnung mir selbst gegenüber. Bewegung, Ernährung und Alltag sind keine Werkzeuge mehr, um einem idealen Körper näherzukommen, sondern Möglichkeiten, gut mit mir umzugehen.
Das fühlt sich nachhaltiger an. Weil es nicht antreibt, sondern trägt. Weil es nicht auf einem inneren Mangel aufbaut, sondern auf dem Wunsch, mich langfristig gesund und stabil zu fühlen.
Selbstwert ohne Bedingungen
Der vielleicht wichtigste Perspektivwechsel war dieser: Mein Wert ist nicht verhandelbar. Er hängt nicht davon ab, wie ich aussehe, wie diszipliniert ich bin oder wie nah ich einem bestimmten Ideal komme.
Selbstwert bedeutet für mich heute, mir selbst mit Respekt zu begegnen. Auch dann, wenn es unordentlich ist. Auch dann, wenn mein Körper nicht meinem Wunschbild entspricht. Dieser Wechsel war leise, aber tiefgreifend. Weg von Bewertung, hin zu Beziehung. Gerade der ständige Anspruch, es richtig oder perfekt machen zu müssen, hat lange dazu beigetragen, diesen Wert an Bedingungen zu knüpfen. Wenn du dich darin wiedererkennst, findest du dazu eine ehrliche Einordnung im Beitrag: Nie Gut Genug? Die brutale Wahrheit über Perfektionismus.
Selbstliebe heute und was ich rückblickend gelernt habe

Selbstliebe fühlt sich für mich heute anders an als früher. Nicht spektakulär, nicht euphorisch, nicht konstant. Aber zumindest stabiler. Sie ist kein Hochgefühl mehr, sondern etwas, das im Hintergrund trägt. An manchen Tagen ist sie leise, an anderen präsenter. Doch sie verschwindet nicht mehr komplett, nur weil etwas wackelt.
Was sich verändert hat, ist vor allem der innere Umgang mit mir selbst. Es gibt weniger Kampf. Weniger das Gefühl, mich korrigieren oder verbessern zu müssen, um okay zu sein. Stattdessen mehr Annahme. Nicht im Sinne von Aufgeben, sondern im Sinne von Ehrlichkeit. Ich sehe klarer, wo ich stehe, ohne mich dafür abzuwerten oder kleiner zu machen, so wie früher.
Ich habe gelernt, dass Selbstliebe nichts mit Perfektion zu tun hat. Sie zeigt sich nicht darin, alles im Griff zu haben oder immer richtig mit sich umzugehen. Sondern darin, wie ich mir begegne, wenn es nicht rund läuft. Wenn Unsicherheit da ist. Wenn alte Muster anklopfen.
Was ich meinem Jüngeren Ich sagen würde
Rückblickend würde ich meinem jüngeren Ich gern sagen, dass Selbstliebe kein Ziel ist, das man erreicht und dann abhakt. Sie ist eine Beziehung. Und wie jede Beziehung verändert sie sich, fordert heraus, braucht Aufmerksamkeit und Geduld. Sie darf wachsen, stocken, sich neu sortieren.
Mein Wert schwankt nicht mit meinem Körper. Nicht mit meinem Gewicht, nicht mit meinem Spiegelbild, nicht mit meiner Disziplin und nicht mit meinem Charakter. Das zu verstehen war kein einzelner Moment, sondern ein Prozess. Einer, der Zeit gebraucht hat und es immer noch braucht.
Heilung ist nichts, das man abschließt. Sie ist etwas, das man lebt. In kleinen Entscheidungen, im Alltag, in der Art, wie man mit sich selbst spricht. Und genau darin liegt für mich heute Selbstliebe. Nicht als Ideal, sondern als Praxis.
Für dich, falls du dich darin wiedererkennst
Wenn du dich in diesem Beitrag wiedergefunden hast, möchte ich dir zuerst eines sagen: Du bist damit nicht allein. Und es ist nichts falsch an dir. Viele dieser inneren Prozesse passieren still. Ohne große Worte, ohne sichtbare Brüche. Nach außen funktioniert alles, während innen längst Fragen entstanden sind.
Vielleicht kennst du dieses leise Ringen mit dir selbst. Dieses Gefühl, immer wieder an dir zu arbeiten und trotzdem nicht anzukommen. Vielleicht ist deine Beziehung zu deinem Körper wechselhaft. Vielleicht glaubst du, dass Selbstliebe sich anders anfühlen müsste als das, was du gerade erlebst.
Wenn das so ist, dann darfst du wissen: Selbstliebe ist kein dauerhafter Zustand von Sicherheit oder Zufriedenheit. Sie darf wackeln. Sie darf leise sein. Sie darf Zeit brauchen. Du musst nicht an einem bestimmten Punkt sein, um wertvoll zu sein.
Vielleicht beginnt Selbstliebe für dich nicht mit einem großen Umdenken, sondern mit einem sanfteren Blick auf dich selbst. Mit weniger Druck. Mit der Erlaubnis, unfertig zu sein, ohne dich dafür abzuwerten.
Wenn du magst, nimm dir einen Moment und spüre in diese Fragen hinein, ohne sie sofort beantworten zu müssen:
- Wann fühlst du dich dir selbst nahe, ganz unabhängig von deinem Körper?
- Woran machst du deinen Wert heute noch fest, auch wenn es dich eigentlich müde macht?
- Was würde sich verändern, wenn du dich selbst nicht ständig korrigieren müsstest?
Vielleicht entstehen keine klaren Antworten. Vielleicht nur ein Gefühl, ein Gedanke, ein leiser Impuls. Auch das reicht. Manchmal ist genau das der Anfang.
Fazit
Meine Beziehung zur Selbstliebe war nie geradlinig. Sie hat sich verändert, verschoben, manchmal verloren und wiedergefunden. Von kindlicher Selbstverständlichkeit über Zweifel, Kontrolle und innere Brüche bis hin zu einer Haltung, die heute weniger laut, aber tragfähiger ist.
Was ich gelernt habe, ist nicht, wie man sich immer gut fühlt. Sondern wie man bei sich bleibt, auch wenn es schwierig wird. Selbstliebe bedeutet für mich heute nicht, alles an mir zu mögen oder ständig im Reinen mit mir zu sein. Sie zeigt sich in dem Umgang, den ich mit mir selbst pflege. Wie ich mit und über mich rede. In Fürsorge statt Kampf. In Beziehung statt Bewertung.
Mein Körper ist dabei kein Maßstab mehr für meinen Wert, sondern Teil meiner Geschichte. Bewegung, Ernährung und Alltag sind keine Werkzeuge zur Selbstoptimierung, sondern Möglichkeiten, gut mit mir umzugehen. Nicht perfekt, aber bewusst. Ähnlich erlebe ich auch innere Prozesse wie Selbstreflexion und Schattenarbeit – sie sind kein Ziel, das man erreicht, sondern ein Raum, in dem man sich selbst begegnet. Wenn dich das interessiert, findest du dazu auch Gedanken in meinem Beitrag :Schattenarbeit & Selbstfindung: Wer bist du, wenn niemand hinsieht?
Vielleicht ist Selbstliebe am Ende nichts, das man erreicht, sondern etwas, das man immer wieder wählt. In kleinen Momenten. In leisen Entscheidungen. Und genau darin liegt für mich heute ihre Kraft.
Alles liebe und bis zum nächsten mal,
Deine Alice ✨