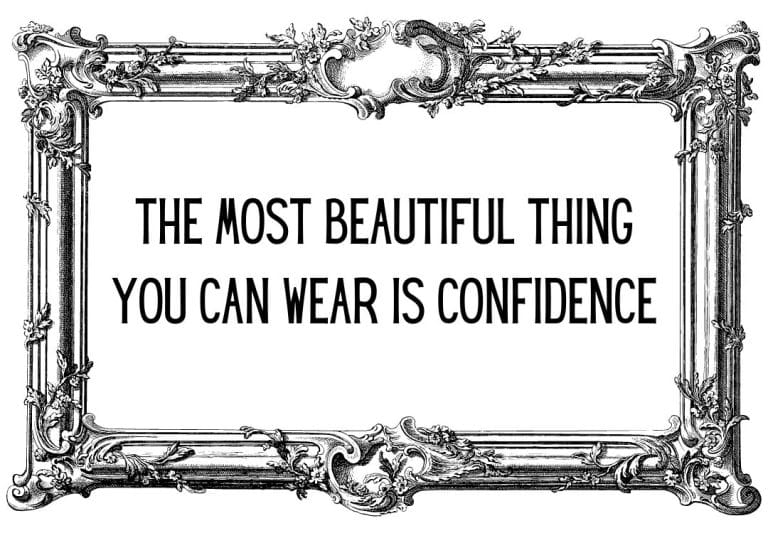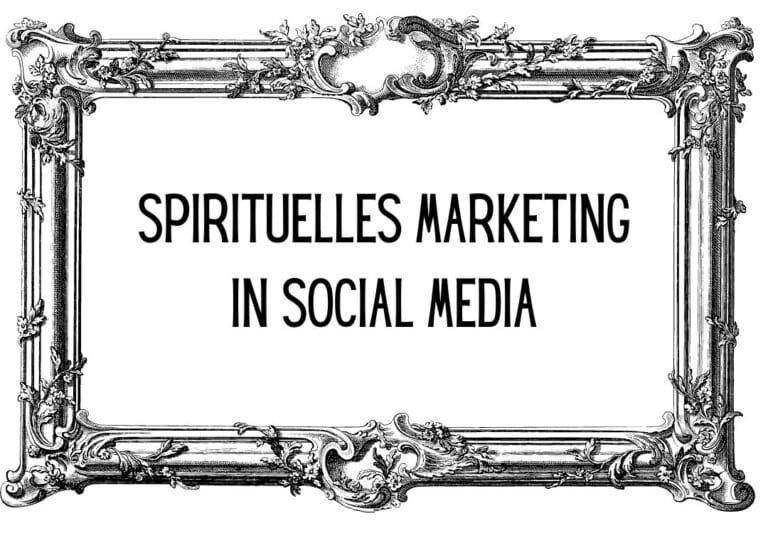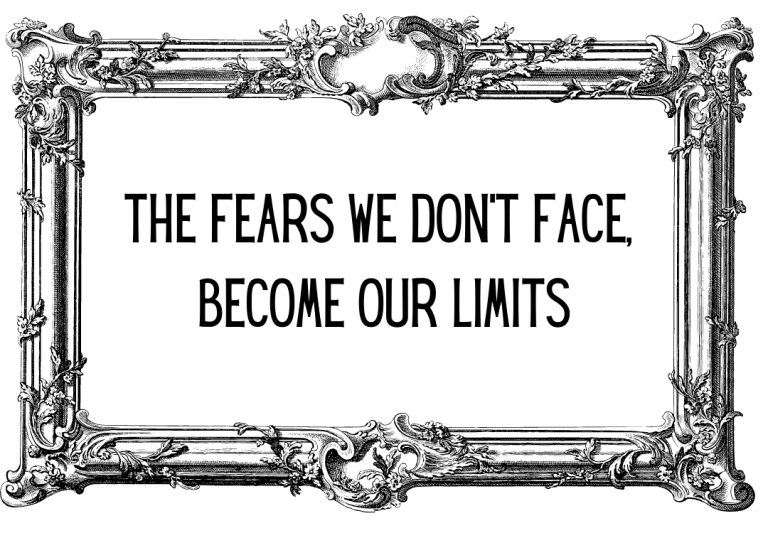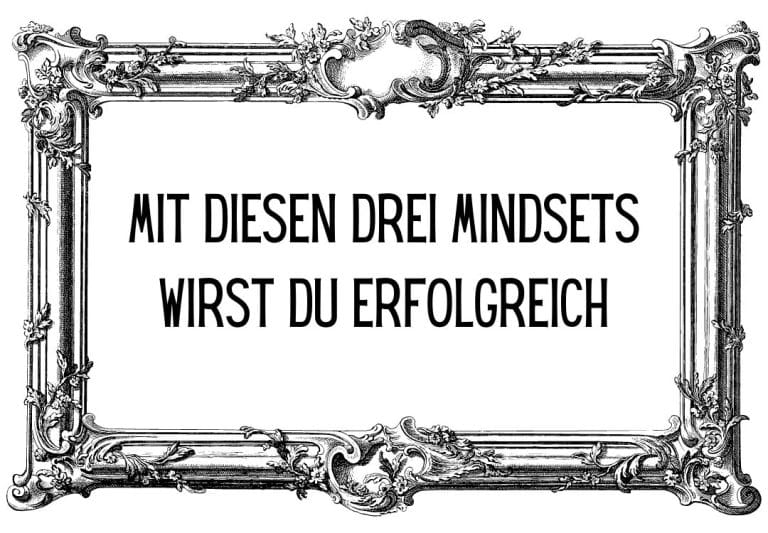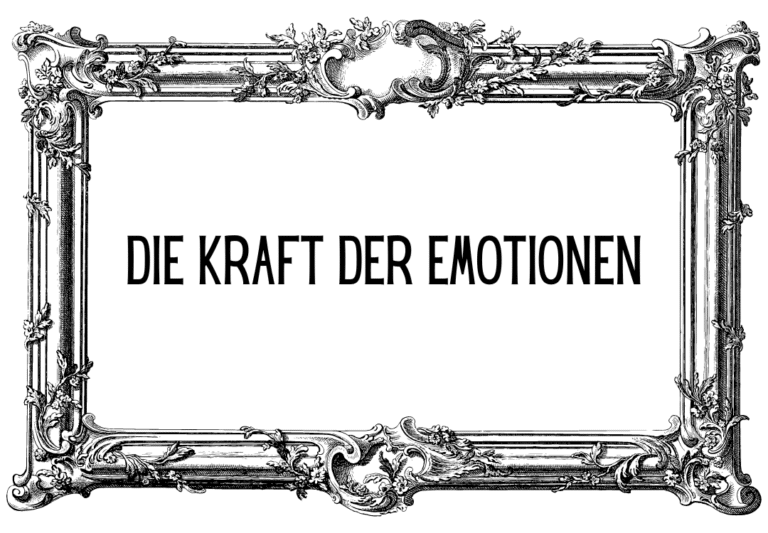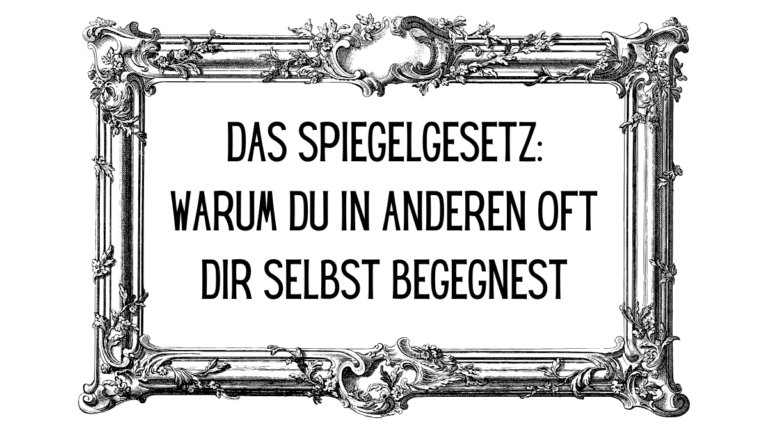Manchmal, wenn mich eine Panikattacke überrollt, geschieht etwas, das sich schwer in Worte fassen lässt. Es ist, als würde mein Körper plötzlich nicht mehr mir gehören. Ich sehe meine Hände, aber sie wirken fremd. Die Stimmen um mich herum klingen gedämpft, die Welt scheint hinter Glas zu liegen. Ich bin da und gleichzeitig irgendwie nicht. Dieses seltsam entrückte Gefühl hat Namen: Depersonalisation und Derealisation.
In diesem Beitrag möchte ich dir erzählen, was hinter diesen Phänomenen steckt, warum sie so oft in Verbindung mit Angst und Panik auftreten und was (mir persönlich) hilft, wieder Boden unter den Füßen zu spüren. Vor allem aber möchte ich dir zeigen: Wenn du das auch schon erlebt hast, bist du nicht allein.
Der Zusammenhang zwischen Panikattacken und Dissoziation
Panikattacken sind wie ein Sturm im Nervensystem. Innerhalb weniger Sekunden gerät alles außer Kontrolle: Herzklopfen, Schwindel, Atemnot, Zittern. Viele Betroffene beschreiben das Gefühl, gleich umzufallen, die Kontrolle zu verlieren oder sogar zu sterben. Inmitten dieser Welle kann es passieren, dass der Kopf einen „Not-Aus-Schalter“ drückt – und das ist der Moment, in dem Depersonalisation oder Derealisation auftreten.
Der Fachbegriff dafür lautet Dissoziation. Es bedeutet, dass sich Bewusstsein, Wahrnehmung oder Körperempfinden vorübergehend voneinander lösen. Was bedrohlich klingt, ist in Wahrheit ein uraltes Schutzprogramm unseres Körpers.
Wie Panikattacken Depersonalisation/Derealisation auslösen können
Während einer Panikattacke überflutet Adrenalin den Körper. Das Herz rast, die Muskeln spannen sich an, der Atem wird schneller und flacher. Dieses „Kampf-oder-Flucht“-Programm soll uns auf eine Gefahr vorbereiten. Nur: Bei einer Panikattacke gibt es keine reale Gefahr, sondern eine Fehlinterpretation des Körpers.
Weil die innere Alarmanlage auf höchster Stufe läuft, sucht das System nach einem Ausweg. Wenn Kampf oder Flucht nicht möglich sind, schaltet es manchmal auf eine dritte Reaktion um: Abschalten. Der Geist zieht sich zurück, um die Überlastung erträglicher zu machen. Genau das spürst du dann als Depersonalisation (Entfremdung von dir selbst) oder Derealisation (Entfremdung von der Außenwelt).
Typische Symptome während einer Attacke
Viele Betroffene schildern sehr ähnliche Eindrücke, zum Beispiel:
- das Gefühl, den eigenen Körper nur noch wie von außen zu beobachten
- eine plötzliche Distanz zu den eigenen Gedanken („Das denke ich doch nicht wirklich, oder?“)
- die Wahrnehmung, als würde alles um sie herum wie im Traum oder wie auf einer Leinwand wirken
- Geräusche, Farben oder Entfernungen wirken verfremdet
- das Gefühl, gleich die Kontrolle zu verlieren oder „verrückt zu werden“
So beängstigend diese Symptome sind, sie sind typische Stressreaktionen und kein Anzeichen dafür, dass du den Verstand verlierst. Sie bedeuten nicht, dass du dauerhaft in diesem Zustand bleiben wirst.

Subjektives Erleben: Wenn die Realität fremd wirkt
Depersonalisation und Derealisation gehören zu den Erfahrungen, die man schwer beschreiben und noch schwerer nachvollziehen kann, wenn man sie selbst nie erlebt hat. Für Außenstehende wirkt es oft unverständlich – für Betroffene dagegen ist es zutiefst verunsichernd. Plötzlich fühlt sich alles anders an, ohne dass sich äußerlich etwas geändert hätte.
Gefühl der Entfremdung vom eigenen Körper (Depersonalisation)
Depersonalisation bedeutet, dass du dich von dir selbst getrennt erlebst. Viele berichten, dass sie ihre Bewegungen zwar ausführen, sich dabei aber wie ein Beobachter fühlen. Auch Gedanken und Gefühle können fremd wirken, fast so, als gehörten sie nicht zu einem selbst.
Manche beschreiben es, als würden sie in einem Film mitspielen, in dem sie zwar die Hauptrolle haben, aber keine Kontrolle über die Handlung. Andere empfinden es wie eine „Nebelwand“ zwischen sich und ihrem Körper. Dieses Gefühl löst oft starke Angst aus, weil es den Kern der Identität berührt.
Gefühl, dass die Welt unwirklich erscheint (Derealisation)
Bei der Derealisation verlagert sich das Empfinden nach außen. Die Umwelt wirkt plötzlich seltsam verfremdet. Räume scheinen sich zu verschieben, Farben sind blasser oder greller, Geräusche klingen gedämpft oder hohl. Selbst vertraute Orte können bedrohlich fremd wirken.
Manchmal fühlt es sich an, als würde man durch eine Glasscheibe schauen oder als sei die Welt nur eine Kulisse. Diese Entfremdung von der Umgebung kann das Gefühl verstärken, „den Verstand zu verlieren“, obwohl es in Wahrheit ein Symptom von Überlastung ist.
Beispiele, wie Betroffene es beschreiben
Weil Worte diese Zustände nur unzureichend erfassen, greifen Betroffene oft zu Metaphern, wie zum Beispiel:
- „Es fühlt sich an, als wäre ich ein Roboter, der automatisch funktioniert.“
- „Alles ist wie im Traum, ich bin da, aber irgendwie auch nicht.“
- „Ich sehe die Welt, aber sie wirkt zweidimensional, wie auf einem Bildschirm.“
- „Meine Stimme klingt fremd, fast so, als würde jemand anders sprechen.“
Solche Beschreibungen zeigen, wie intensiv und gleichzeitig schwer greifbar diese Erlebnisse sind. Wichtig ist, sich bewusst zu machen: So seltsam und erschreckend es wirkt, es ist ein bekanntes Phänomen, das viele Menschen teilen – besonders im Zusammenhang mit Panikattacken.

Ursachen und Auslöser
Depersonalisation und Derealisation wirken auf den ersten Blick wie ein Rätsel. Doch wenn man genauer hinschaut, zeigen sich klare Zusammenhänge. Sie entstehen nicht zufällig, sondern sind Reaktionen des Körpers und des Geistes auf Überlastung. Das Verständnis der Ursachen kann helfen, weniger Angst vor diesen Zuständen zu haben.
Biologische und psychologische Faktoren
Unser Nervensystem ist darauf ausgelegt, Gefahren zu erkennen und blitzschnell zu reagieren. Gerät es in einen Dauerzustand von Stress oder Angst, kann es zu einer Art „Kurzschluss“ kommen. Neurotransmitter, die normalerweise unsere Wahrnehmung regulieren, geraten aus dem Gleichgewicht.
Psychologisch gesehen handelt es sich um eine Dissoziation: eine Abspaltung von Gefühlen, Gedanken oder Körperempfindungen, um die Belastung erträglicher zu machen. Menschen mit einer hohen Sensibilität oder einer Neigung zu Angststörungen sind dafür besonders anfällig.
Stress, Angst und Traumata als Trigger
Starker Stress ist einer der häufigsten Auslöser. Ob Überforderung im Alltag, seelischer Druck oder traumatische Erlebnisse – wenn das System zu viel aushalten muss, sucht es nach einem Ventil. Depersonalisation und Derealisation sind dann wie ein „Notprogramm“, das Abstand schafft.
Auch Traumata spielen eine Rolle. Wer in der Vergangenheit schmerzhafte Erfahrungen gemacht hat, kann in belastenden Situationen schneller in eine dissoziative Reaktion rutschen. Es ist eine alte Überlebensstrategie, die in der Gegenwart wieder aktiviert wird. Eine tiefergehende Betrachtung der Rolle von Angst findest du in meinem Beitrag: Der Angst in die Augen schauen
Rolle von Hyperventilation und körperlicher Anspannung
Ein weiterer Auslöser ist die Hyperventilation, die oft während Panikattacken auftritt. Durch das schnelle, flache Atmen sinkt der Kohlendioxidgehalt im Blut. Das führt zu Schwindel, Benommenheit und verändertem Bewusstsein – ein perfekter Nährboden für Depersonalisation und Derealisation.
Auch chronische Muskelanspannung kann das Gefühl verstärken, vom eigenen Körper getrennt zu sein. Wer dauerhaft in Alarmbereitschaft lebt, nimmt sich selbst irgendwann nicht mehr richtig wahr.
Fazit: Ursachen und Auslöser sind vielfältig, aber sie folgen einem Muster. Sie zeigen nicht, dass „etwas kaputt“ ist, sondern dass Körper und Geist versuchen, mit einer extremen Belastung umzugehen.
Wie man Depersonalisation und Derealisation erkennt
Wer Depersonalisation oder Derealisation erlebt, hat oft große Angst, etwas Schlimmes würde passieren. Manche fürchten, verrückt zu werden oder eine schwere psychische Krankheit zu entwickeln. Doch genau hier hilft Wissen: Depersonalisation und Derealisation sind typische Stressreaktionen – und sie unterscheiden sich klar von anderen Erkrankungen.
Unterschied zu Psychosen oder anderen Erkrankungen
Ein häufiger Irrtum ist die Angst, dass man eine Psychose entwickelt. Bei einer Psychose verlieren Betroffene tatsächlich den Bezug zur Realität. Sie erleben Halluzinationen oder haben Wahnvorstellungen, die sie nicht mehr infrage stellen.
Bei Depersonalisation und Derealisation ist das anders: Du weißt, dass etwas „nicht stimmt“. Du merkst, dass dein Erleben verändert ist, und genau dieses Bewusstsein unterscheidet die Zustände von einer Psychose.
Auch körperliche Erkrankungen wie Migräne, Epilepsie oder Nebenwirkungen von Medikamenten können ähnliche Symptome auslösen. Deshalb ist es immer sinnvoll, bei Unsicherheit medizinischen Rat einzuholen. Doch in den meisten Fällen, besonders im Zusammenhang mit Angststörungen, sind es harmlose, wenn auch sehr belastende Symptome.
Warnsignale und typische Muster
Es gibt einige Anzeichen, die darauf hinweisen, dass es sich um Depersonalisation oder Derealisation handelt:
- Bewusstsein bleibt erhalten: Du nimmst die Veränderung wahr und zweifelst daran.
- Keine bleibende Störung: Die Symptome kommen in Episoden, oft in Zusammenhang mit Stress oder Panikattacken.
- Gefühl der Entfremdung, nicht des Kontrollverlusts: Du fühlst dich fremd, aber nicht „weg“.
- Auslöser erkennbar: Häufig tritt es in belastenden Situationen oder nach Übermüdung auf.
Typisch ist auch, dass die Angst vor den Symptomen selbst sie verstärken kann. Je mehr man dagegen ankämpft, desto länger halten sie an.
Fazit: Depersonalisation und Derealisation sind keine Anzeichen dafür, dass du „den Verstand verlierst“. Sie sind Ausdruck einer überlasteten Psyche und eines überreizten Nervensystems. Das Wissen darüber ist oft der erste Schritt, um die Angst davor zu lösen.
Strategien im Akutfall
Wenn Depersonalisation oder Derealisation während einer Panikattacke auftreten, fühlt es sich oft so an, als gäbe es keinen Ausweg. Doch genau in diesem Moment helfen kleine, praktische Schritte, um wieder im Hier und Jetzt anzukommen. Es geht nicht darum, die Symptome sofort „wegzumachen“, sondern deinem Nervensystem ein Signal zu senden: Du bist sicher.
Erdungstechniken (z. B. 5-4-3-2-1-Methode, Atmung)
Eine der wirksamsten Methoden ist das Erden. Du lenkst deine Aufmerksamkeit bewusst auf deine Sinne, um dich wieder mit deinem Körper und deiner Umgebung zu verbinden.
Die bekannte 5-4-3-2-1-Methode funktioniert so:
- 5 Dinge sehen
- 4 Dinge fühlen (z. B. Kleidung auf der Haut, Hände auf den Oberschenkeln)
- 3 Dinge hören
- 2 Dinge riechen
- 1 Sache schmecken
Auch bewusstes Atmen beruhigt das Nervensystem. Versuche, tief durch die Nase einzuatmen, bis vier zu zählen, und langsam durch den Mund wieder auszuatmen, bis sechs zu zählen. Allein diese einfache Technik kann die Intensität der Symptome deutlich reduzieren.
Selbstberuhigung und Achtsamkeit
Sprich innerlich beruhigend mit dir. Sätze wie „Das ist nur eine Stressreaktion. Es geht vorbei. Ich bin sicher.“ können helfen, die Angstschleife zu unterbrechen.
Achtsamkeit bedeutet hier, die Empfindungen nicht zu verdrängen, sondern sie neugierig wahrzunehmen – ohne sie zu bewerten. Wenn du bemerkst: „Mein Körper fühlt sich gerade fremd an“, dann benennst du das nur, ohne dagegen anzukämpfen. Paradoxerweise nimmt das den Druck und verringert die Intensität. (Eine einfache Einführung in Achtsamkeitstechniken findest du im Beitrag: Was ist Achtsamkeit im Alltag? 5 ultimative Techniken)
Warum Widerstand die Symptome verstärken kann
Viele Betroffene versuchen verzweifelt, gegen das Gefühl anzukämpfen. Doch das macht die Symptome oft schlimmer. Der Grund: Kampf bedeutet für das Nervensystem erneut Alarm – und die Überlastung verstärkt sich.
Stattdessen hilft es, die Symptome als vorübergehende Stressreaktion zu akzeptieren. Das bedeutet nicht, dass du sie gutheißen musst, sondern dass du sie wie eine Welle betrachtest: Sie baut sich auf, erreicht einen Höhepunkt und klingt dann wieder ab. Je weniger du sie bekämpfst, desto schneller zieht sie vorbei.
Fazit: Im Akutfall zählt nicht Perfektion, sondern kleine Schritte. Jeder tiefe Atemzug, jeder bewusste Sinneseindruck bringt dich zurück ins Hier und Jetzt. Mit der Zeit lernst du, deinem Körper zu vertrauen – und das nimmt den Symptomen viel von ihrem Schrecken.

Langfristige Ansätze zur Linderung
Akutstrategien helfen dir, eine Episode zu überstehen. Doch um Depersonalisation und Derealisation langfristig zu lindern, braucht es einen tieferen Blick: Wie kannst du dein Nervensystem stabilisieren, Stress abbauen und einen sicheren Umgang mit deiner Angst entwickeln? Die gute Nachricht: Es gibt viele Wege, die dir dabei helfen können.
Therapieformen (z. B. kognitive Verhaltenstherapie)
Eine der bewährtesten Methoden ist die kognitive Verhaltenstherapie (KVT). Hier lernst du, die typischen Gedankenmuster zu erkennen, die Panikattacken und Dissoziation aufrechterhalten. Schritt für Schritt wirst du darin unterstützt, die Angst vor den Symptomen zu verlieren.
Auch andere Therapieformen wie traumafokussierte Verfahren, somatic experiencing oder achtsamkeitsbasierte Ansätze können hilfreich sein – besonders dann, wenn frühere Erfahrungen oder unverarbeitete Emotionen eine Rolle spielen. Wichtig ist, dass du dich mit deinem Therapeuten oder deiner Therapeutin sicher fühlst.
Körperarbeit und Entspannungstechniken
Unser Körper spielt eine zentrale Rolle. Wenn er ständig in Alarmbereitschaft ist, verstärken sich die Symptome. Deshalb ist es sinnvoll, regelmäßig Methoden zu üben, die das Nervensystem beruhigen, zum Beispiel:
- Progressive Muskelentspannung: Muskeln anspannen und bewusst wieder loslassen.
- Yoga oder sanftes Stretching: Verbindung von Atem und Bewegung.
- Meditation oder Atemübungen: Stärken die Fähigkeit, präsent zu bleiben.
Auch einfache Dinge wie Spaziergänge in der Natur oder regelmäßige Bewegung können helfen, das innere Gleichgewicht zurückzubringen.
Umgang mit Angst vor der Symptomatik
Ein Teufelskreis entsteht oft dadurch, dass man Angst vor der Angst hat. Wer einmal Depersonalisation oder Derealisation erlebt hat, fürchtet sich davor, dass es wiederkommt. Diese Erwartungsangst allein kann schon neue Episoden auslösen.
Der Schlüssel liegt darin, die Symptome nicht mehr als Bedrohung zu bewerten. Sie sind ein Signal des Körpers, dass er überlastet ist – nicht mehr und nicht weniger. Mit der Zeit kannst du lernen, sie wie eine vorübergehende Welle zu betrachten. Je weniger du sie fürchtest, desto seltener und schwächer treten sie auf.
Fazit: Langfristige Stabilität entsteht nicht über Nacht. Doch wenn du kontinuierlich für deinen Körper und deine Psyche sorgst, kannst du Depersonalisation und Derealisation deutlich abschwächen. Es ist ein Prozess, bei dem kleine Schritte große Wirkung haben.
Mein persönlicher Umgang damit
Theorie und Techniken sind hilfreich – aber am Ende zählt, was sich im echten Leben bewährt. Ich habe selbst erlebt, wie beängstigend Depersonalisation und Derealisation sein können, besonders während einer Panikattacke. Mit der Zeit habe ich Wege gefunden, die mir helfen, in diesen Momenten besser klarzukommen. Vielleicht kann auch für dich etwas davon nützlich sein.
Akzeptanz statt Kampf
Der wichtigste Schritt war für mich, die Symptome nicht mehr als Feind zu sehen. Früher habe ich innerlich gekämpft: „Das darf nicht passieren!“ Doch dieser Widerstand hat alles nur schlimmer gemacht. Heute sage ich mir: „Okay, mein Körper schaltet gerade in den Schutzmodus. Es fühlt sich komisch an, aber es geht vorbei.“ Diese Akzeptanz nimmt sofort etwas von der Panik heraus.
Kälte als Anker: Eispacks
Etwas, das mir überraschend hilft, sind Eispacks. Wenn ich sie an meine Stirn oder an das Schlüsselbein (Collar Bone) lege, spüre ich den intensiven Reiz sofort. Die Kälte zieht meine Aufmerksamkeit in den Körper zurück und unterbricht das Gefühl der Entfremdung. Es ist fast wie ein Reset-Knopf fürs Nervensystem.
Rückzug in Ruhe
Manchmal brauche ich einfach einen Ort, an dem alles still wird. Ein komplett dunkler Raum oder das bewusste Schließen meiner Augen helfen mir, Reize auszublenden. So kann sich mein System schneller beruhigen. Ich sage dann auch klar zu anderen: „Ich brauche kurz Ruhe.“ Allein dieses Aussprechen gibt mir ein Gefühl von Selbstbestimmung.
Atemübungen
Mein Atem ist mein stärkster Verbündeter. Besonders hilfreich finde ich eine Technik, bei der ich durch ein Nasenloch ein- und durch das andere wieder ausatme. Das klingt vielleicht ungewöhnlich, wirkt aber sofort regulierend auf mein Nervensystem. Auch bewusstes, langsames Atmen bringt mich zurück ins Hier und Jetzt.
Bewegung: Gehen hilft
Wenn die Anspannung sehr stark ist, hilft es mir, aufzustehen und mich zu bewegen. Ein Spaziergang, selbst nur ein paar Schritte, signalisiert meinem Körper: „Alles ist in Ordnung, ich bin handlungsfähig.“ Das einfache Gehen stabilisiert und bringt Energie wieder ins Fließen.
Fazit: Diese Strategien sind meine persönlichen Anker – sie ersetzen keine Therapie, aber sie geben mir Sicherheit im Alltag. Vielleicht findest du für dich ähnliche kleine Hilfen, die genau zu deinem Körper und deinem Leben passen. Wichtig ist: Du bist nicht ausgeliefert, es gibt immer Wege, wieder Boden unter den Füßen zu spüren.
Fazit: Du bist nicht allein
Depersonalisation und Derealisation gehören zu den verstörendsten Begleitern einer Panikattacke. Sie lassen dich an dir selbst zweifeln und die Welt fremd erscheinen. Doch so beängstigend diese Zustände auch sind – sie sind nicht gefährlich und sie sagen nichts darüber aus, dass du „verrückt“ wirst. Sie sind ein Ausdruck deines überlasteten Nervensystems, ein Schutzmechanismus, den viele Menschen kennen.
Das Wichtigste ist: Du bist nicht allein. Zahlreiche Menschen machen ähnliche Erfahrungen, und es gibt Wege, mit diesen Symptomen umzugehen. Akut helfen Erdung, Atmung, Kälte oder Rückzug in Ruhe. Langfristig kannst du lernen, dein Nervensystem zu stabilisieren, mit Angst anders umzugehen und die Symptome weniger bedrohlich zu erleben.
Vielleicht klingt das im Moment noch weit entfernt – aber auch kleine Schritte machen einen Unterschied. Schon das Wissen, was mit dir geschieht, kann die Angstspirale durchbrechen. Und wenn du merkst, dass es dich stark belastet, darfst du dir jederzeit Hilfe holen. Therapie, Austausch mit anderen Betroffenen und liebevolle Selbstfürsorge sind wertvolle Ressourcen.
Am Ende bleibt: Diese Zustände definieren dich nicht. Sie sind ein Teil deiner Erfahrung, aber nicht dein ganzes Leben. Vertrauen, Geduld und Akzeptanz können den Weg erleichtern – und dir zeigen, dass du trotz allem sicher bist.